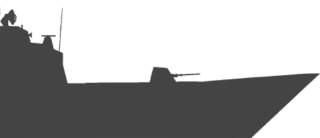Feuerleitung
Die ersten optischen Systeme
Ende des 19. Jahrhunderts betrug die übliche Gefechtsentfernung der Schiffsartillerie selten mehr als 3.000 Meter. Gezielt wurde wie in den Jahrhunderten zuvor noch immer nach Sicht mit dem bloßen Auge und einfachen Visiereinrichtungen oder auch mithilfe von Teleskop-Visieren. Die Trefferquote in einem Gefecht bei diesen Entfernungen lag bei unter 5 %. Die ballistische Reichweite der modernen großkalibrigen Geschütze ging jedoch schon deutlich darüber hinaus. Auch die Weiterentwicklung der Torpedowaffe mit immer größerer Reichweite zwang die Flotten auf größerer Entfernung zu kämpfen.
Für eine bessere Präzision bzw. für den Kampf auf größere Distanz, war es Voraussetzung die Entfernung zum Gegner möglichst genau zu kennen. Die ersten Methoden zur optischen Entfernungsmessung, wie der „Fiske Range Finder“ oder Variationen des „Watkin Mekometer“, erwiesen sich auf See jedoch als zu ungenau. Auch mit den ersten handlichen und einfach zu bedienenden Stadimeter-Winkelmessinstrumenten erhöhte sich die Genauigkeit auf größerer Entfernung nur unwesentlich. Zudem musst das Ziel korrekt identifiziert werden, um die richtige Entfernung berechnen zu können. Stadimeter wurden in der Folge vorwiegend in U-Boot-Periskopen eingesetzt, da dort komplexere Systeme nicht eingebaut werden konnten.
1893 wurde der erste optische Koinzidenzentfernungsmesser (coincidence rangefinder) des schottischen Optikherstellers „Barr & Stroud“ bei der Royal Navy eingeführt, der „Barr & Stroud FA1“ (Basislänge 1,4 Meter = 4,5 Fuß). Die deutsche Firma Carl Zeiss folgte 1899 mit dem Raumbildentfernungsmesser (stereoscopic rangefinder), in der deutschen Marine ab ca. 1908 als „Basisgerät“ (B.G.) eingeführt. Die Mechanik der beiden Systeme war sehr ähnlich, in der Anwendung gab es aber Unterschiede. Koinzidenzentfernungsmesser wurden als Monokular relativ einfach mit nur einem Auge bedient und in fast allen Marinen eingesetzt. Der in der deutschen Marine bevorzugte Raumbildentfernungsmesser war ein Binokular und stellte hohe Ansprüche an das räumliche Sehvermögen des Anwenders. Als Vorteil wird die bessere Handhabung bei schlechten Sichtverhältnissen, besonders auf große Entfernung genannt.
In der Seeschlacht bei Tsushima im Mai 1905 wurde das Gefecht zeitweise schon auf einer Entfernung von 7.000 Meter ausgetragen. Die japanischen Linienschiffe verfügten dabei über „Barr & Stroud FA3“-Entfernungsmesser (verfügbar ab 1903). In der russischen Flotte waren überwiegend einfache Stadimeter-Messinstrumenten im Einsatz, nur zwei ihrer Linienschiffe verfügten über ältere „Barr & Stroud FA2“-Entfernungsmesser (verfügbar ab 1895). Für noch größere Entfernung wurde es aufgrund der Flugzeit der Geschosse erforderlich auch die Position des Ziels vorherzusagen. Dies geschah mithilfe weiterer technischer Entwicklungen wie z.B. der Argo-Uhr und Dreyer Table. In der Skagerrakschlacht im Mai 1916 betrug die Gefechtsentfernung schon 15.000 Meter und mehr.
Ab den 1920er Jahren wurden auf den Schlachtschiffen und Kreuzern Bordflugzeuge mitgeführt, die neben der Aufklärung und auch zur Artilleriebeobachtung eingesetzt wurden. Durch Beobachten der Einschläge der eigenen Artillerie auf ein Ziel und Korrekturangaben über Funk konnte so die Artillerie-Feuerleitung auf große Entfernung unterstützt werden.
Feuerleitung durch Radar
Mit der Entwicklung des Radars in den 1930er Jahren wurden die optischen Entfernungsmesser bald überflüssig. Radargeräte waren wesentlich genauer und funktionierte auch nachts sowie bei schlechtem Wetter. Die optischen Systeme blieben zwar noch an Bord, aber das Radar wurde schnell zur bevorzugten Quelle für Entfernungsdaten und bald auch für Höhendaten zur Flugabwehr.
Die größten Entfernungen in der ein Schlachtschiff jemals einen Treffer auf See erzielte, betrug in beiden Fällen ungefähr 24.000 Meter. Im Juni 1940, das Schlachtschiff ‚Scharnhorst‘ gegen die HMS ‚Glorious‘ und im Juli 1940 die HMS ‚Warspite‘ gegen das italienische Schlachtschiff ‚Guilio Cesare‘.
Feuerleitung von Flugkörpern